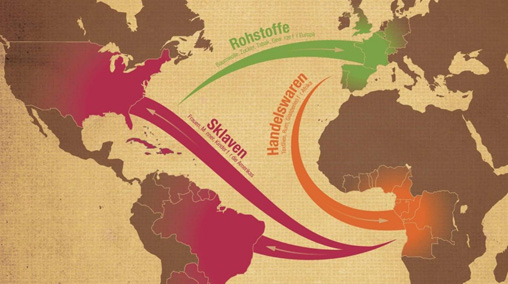Eine Studie zeigt, dass sich die Mobilität zwischen den Gesellschaftsklassen in der Schweiz während des 20. Jahrhunderts nicht verbessert hat. Besonders für Leute aus der ArbeiterInnenklasse bleibt der Weg nach oben versperrt. Ein Gespräch mit Julie Falcon.
Die Soziologin Julie Falcon hat in ihrer Forschungsarbeit die Daten von Personen untersucht, die zwischen 1908 und 1978 geboren sind, und sie in drei Kategorien unterteilt: Obere Mittelschicht (Kader, ChefInnen, IngenieurInnen, AkademikerInnen), Mittelschicht (kleiner HändlerInnen, HandwerkerInnen und BäuerInnen) und ArbeiterInnenklasse (untere Angestellte und ArbeiterInnen).
Laut Ihrer Studie konnten vier von zehn Personen in eine höhere Gesellschaftsklasse aufsteigen im Vergleich zu ihren Eltern. Ist das nicht schon viel?
Klar, man kann das Glas als halb voll oder halb leer betrachten. Man muss allerdings ergänzen, dass 40 Prozent der Untersuchten in der gleichen Klasse blieben und 20 Prozent abgestiegen sind. Das Interessante daran ist, dass dieses Verhältnis während des 20. Jahrhunderts stabil geblieben ist. Die Leute meinen, dass sich ihre Perspektive für einen sozialen Aufstieg verbessert hat. In Wirklichkeit hat diese Öffnung nach oben nicht wirklich stattgefunden.
Wie können Sie sich das erklären?
Die Plätze an der Spitze der sozialen Hierarchie bleiben von Personen besetzt, die für die Erhaltung ihrer Privilegien kämpfen. Auch das Bildungssystem der Schweiz begünstigt diese Fortentwicklung. Die Selektion beginnt schon früh, bis zu einem Alter, in dem die Bildung nicht mehr viel Zeit hat, um die Chancen auszugleichen. Im internationalen Vergleich ist die schweizerische Gesellschaft ziemlich starr geblieben. Das trifft auch auf Deutschland zu, das ein sehr ähnliches Bildungssystem kennt.
In der Schweiz setzt man stark auf die Lehre. Hilft die Berufsbildung, die soziale Leiter hochzuklettern?
Wir stehen vor einem Paradox: Der Weg über die Lehre ist sakrosankt. Es stimmt, dass man mit ihr relativ einfach eine Arbeitsstelle findet. Aber danach ist es nicht einfacher, die soziale Leiter hochzuklettern. Und diejenigen, die es schaffen, stammen in der Regeln bereits aus einer höheren Klasse.
Hat sich die Situation dadurch geändert, dass mehr Menschen an die Universität gehen?
Diese Zunahme betrifft in erster Linie die oberen Klassen, die an unseren Universitäten überrepräsentiert sind. Und selbst auf diesem Bildungsniveau fällt die Herkunft stark ins Gewicht: Die AkademikerInnen, die aus der ArbeiterInnenklasse stammen, haben eine tiefere Chance in eine höhere Klasse aufzusteigen als ihre KommilitonInnen, die «höher geboren» wurden.
Warum?
Man weiss zum Beispiel, dass Personen, die aus einer höheren Gesellschaftsklasse stammen, eher Studienrichtungen wählen, die angesehener sind. Sie studieren Medizin, Recht oder Wirtschaft statt Literatur und Geisteswissenschaften. Ferner ist auch ein gutes Netzwerk wichtig, das die Arbeitssuche erleichtert. Und nicht zu vergessen: Die Leute, die privilegierten Familien angehören, kennen deren Sprache und Codes, was ihnen hilft, sich zu integrieren.
Hat die Entwicklung des Dienstleistungssektors geholfen, die soziale Mobilität zu erleichtern?
Die Arbeitsstellen, die man zur Mittelschicht zählen kann, sind tatsächlich zahlreicher geworden. Aber die ArbeitgeberInnen verlangen nun auch mehr Diplome und das begünstigt diejenigen, die mehr Bildung im Rucksäckchen haben. Letztlich führt diese sogenannte Tertiarisierung zu einer Verstärkung der Ungleichheiten: Menschen mit wenigen oder keinen Abschlüssen können noch weniger gut die soziale Leiter hinauf aufsteigen.
Gibt es die Gefahr, dass sich die Ungleichheiten in den nächsten Jahren vertiefen werden?
Ich vermute es. Die soziale Herkunft scheint noch bedeutsamer geworden zu sein für Personen, die nach 1970 geboren sind. Aber das ist ein neues Phänomen, das noch genauere Studien braucht.
Ist die Mittelschicht besser gestellt als in der Vergangenheit, besonders in finanzieller Hinsicht?
Meine Forschungen behandeln diese Frage nicht. Zudem sind die Kategorien, die ich benutze, durch den Beruf und die Höhe der Verantwortung definiert und nicht durch den Lohn. Aber Studien aus Frankreich zeigen, dass die Instabilität in der Mittelschicht zunimmt. Und das Risiko, in die Unterklasse abzusinken, ist im Anstieg.