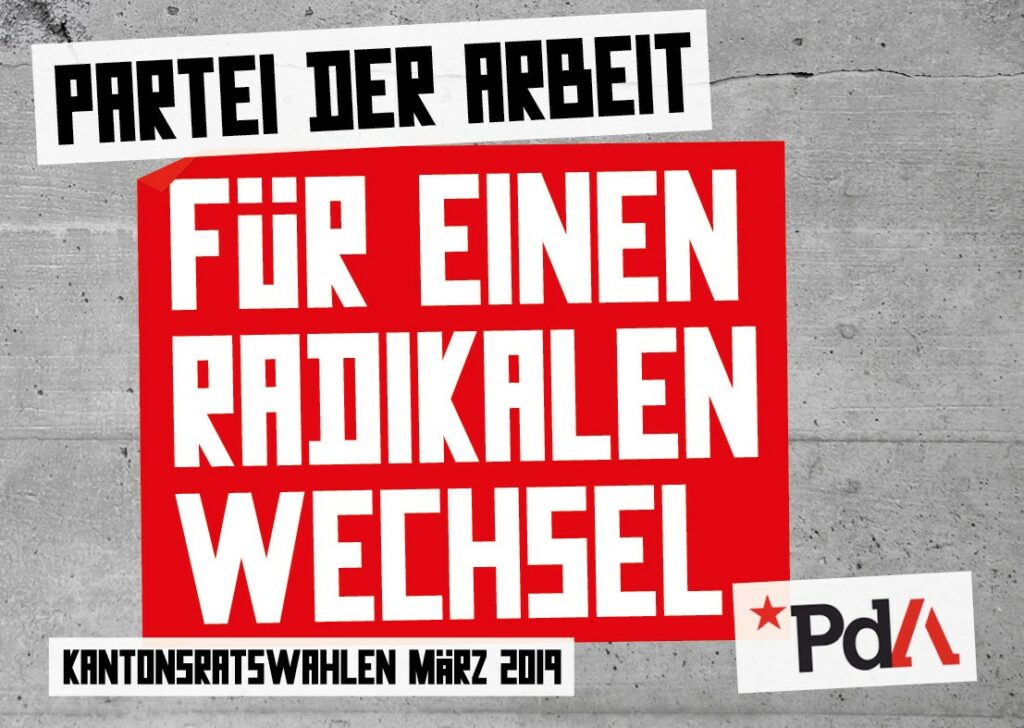In der Fernsehserie «Mr. Robot» versucht ein Hackerkollektiv, den weltgrössten Konzern zu stürzen. Die Show bringt uns dazu, über die Formen des Widerstands gegen den Kapitalismus nachzudenken und wie sie vom Kapital umgelenkt und vereinnahmt werden.
Die Fernsehserie «Mr. Robot» beginnt mit dem Manifest des Protagonisten Elliot Alderson, einem Angestellten einer IT-Sicherheitsfirma und ein Hacker: «Was ich euch erzählen werde, ist topsecret. Es ist eine Verschwörung, grösser als alle von uns. Diese Leute sind unsichtbar. Das obere 1 Prozent des oberen 1 Prozents. Die Leute, die ohne Berechtigung Gott spielen. Und ich glaube, dass sie mich jetzt verfolgen.» Diese ersten dreissig Sekunden umreissen bereits die zwei Schwerpunkte von «Mr. Robot»: Das obere 1 Prozent zerstört die Welt und der Erzähler kann nicht immer die Realität von seiner Vorstellung unterscheiden.
Die Fernsehserie kam als eine Überraschung, als sie letztes Jahr zum ersten Mal über den Bildschirm flimmerte: Es zwingt die ZuschauerInnen, mit einem drogensüchtigen Antikapitalisten zu sympathisieren, der sich möglicherweise das meiste davon einbildet, das ihm bei seinem Versuch, den weltgrössten Konzern zu stürzen, zustösst. «Mr. Robot» hat die Revolution in die Hauptsendezeit gebracht; die Linke sollte deshalb zumindest hinhören, was die Show zu sagen hat.
Halluzinatorische Handlung
Grundsätzlich funktioniert «Mr. Robot» als eine politische Allegorie, die auf das Versagen der progressiven Bewegungen hinweist, etwas zu verändern. In der TV-Serie werden zwei Methoden untersucht, um soziale Veränderung zu bewirken: Elliot (gespielt von Rami Malek) und seine Jugendfreunding Angela (Portia Doubleday) versuchen unabhänigig von einander, an E Corp, einem «too big to fail»-Multi, Rache zu nehmen. Sie grollen dem Unternehmen, weil es einen Chemieunfall verursacht hat, der Elliots Vater und Angelas Mutter getötet hat. Die Konzernspitze musste natürlich keine Strafe verbüssen und hat keine Entschädigungen gezahlt, währenddessen die überlebenden Opfer in Schulden für ihre Pflege ertrinken, Schulden, die sie ausgerechnet bei E Corp haben.
In der ersten Folge wird Elliot von Mr. Robot (Christian Slater) für das Hackerkollektiv «fsociety» rekrutiert. Das Kollektiv arbeitet daran, in die Datenbank von E Corp einzubrechen, um die Schulden der Opfer zu löschen. Etwas stimmt nicht mit Mr. Robot: Niemand spricht direkt mit ihm ausser Elliot, und wenn Mr. Robot spricht, antworten die anderen stattdessen Elliot. Auch wenn es für die ZuschauerInnen relativ bald klar wird, braucht Elliot fast die ganze erste Staffel, um zu begreifen, dass Mr. Robot nur in seiner Vorstellung existiert. Die Spannung zwischen der Vorahnung des Publikums über das wahre Wesen von Mr. Robot und die Weigerung Elliots, sich das einzugestehen, macht die Handlung halluzinatorisch: Wir können nichts davon glauben, was wir auf dem Bildschirm sehen. Dass Elliot drogenabhängig ist, verstärkt dieses Gefühl der Unzuverlässigkeit.
Im gleichen Zeitraum versucht Angela eine Anwältin davon zu überzeugen, die Klage wegen fahrlässiger Tötung gegen E Corp wieder aufzunehmen. Sie arbeitet bei der gleichen IT-Sicherheitsfirma wie Elliot, die mit E Corp unter Vertrag steht, und glaubt, dass sie innerhalb von E Corp besser belastendes Material finden könnte, um Gerechtigkeit für die Opfer des Chemieunfalls zu erlangen. Angela kann sich eine Stelle in der PR-Abteilung des Unternehmens zur angeln, während «fsociety» ihre Mission erfolgreich durchführen kann und E Corp ins Chaos stürzt.
Formen des Widerstands
Zu Beginn der zweiten Staffel befinden sich die Hauptpersonen in der Defensive: Statt ihren Angriff auf E Corp zu verstärken, hackt «fsociety» das FBI, um bei der Ermittlung gegen sie auf dem Laufenden zu bleiben. Angela hat sich währenddessen in der Risikomanagment-Abteilung von E Corp positionieren können; ihr Chef vermutet aber, dass sie in der Klage gegen das Unternehmen involviert ist und traut ihr keine heiklen Informationen an. Schliesslich kann sie jedoch die Daten, die sie braucht, stehlen, entdeckt dabei aber, dass die staatlichen Aufsichtsbehörden unter der Kontrolle von E Corb stehen.
Während wir den Aktivitäten von Elliot und Angela folgen, regt uns die Show dazu an, dir Plotelemente aus «Mr. Robot» mit ihren Gegenstücken aus der wirklichen Welt zu verbinden. Die Hackergruppe «fsociety» ist Anonymous und Occupy; das Logo von E Corp ähnelt dem von Enron, das einst eines grössten Unternehmen der Welt war und bankrott ging; die Computer, die E Corp herstellt, die Versicherungen, die es verkauft, die Banken, die es betreibt, machen das Unternehmen Stellvertreter für Apple, Lehman Brothers und Wells Fargo.
In der zweiten Staffel werden Bilder und Nachrichten eingespielt, um den Zustand der Welt nach dem grossen Hack auf E Corp zu zeigen. Wir sehen Barack Obama über «fsociety» reden. Bilder von Krawallen und Streiks werden gezeigt. Edward Snowden, der bekannte Whistleblower, äussert seine Meinung zur FBI-Untersuchung. Die Einbindung von real existierenden politischen Figuren in den Plot von «Mr. Robot» verstärkt das halluzinatorische Gefühl. Die Welt von «Mr. Robot» ist unsere Welt nur um ein paar Grade verschoben. Das erlaubt es der TV-Serie, die zwei Formen des Widerstands, die die US-Linke in den letzten Jahren genutzt hat – Protest und Veränderung von innen –, dramaturgisch zu verarbeiten. Ebenso die Art, wie sie von der vereinten Macht von Kapital und Staat umgelenkt oder vereinnahmt worden sind. Sowohl «fsociety» wie auch Angela sind stärker im Clinch mit der Staatsmacht als mit ihrem wirklichen Ziel, dem Finanzkapital, und widerspiegeln damit, was mit der Occupy-Bewegung und mit der Kampagne von Bernie Sanders passiert ist. Schliesslich wurde Occupy nicht vom Goldman-Sachs-Konzern aufgelöst, sondern von der Polizei. Ebenso war es «business as usual» bei der Demokratischen Partei: Wenn man den Wahlkampfreden von Hillary Clinton zuhörte oder sich ihren farblosen Vizepräsidentschaftskandidaten ansah, würde einem nie einfallen, dass dieses Jahr ein sozialdemokratischer Aufstand die Partei erschüttert hat. Die Probleme der Kampagne von Bernie Sanders zeigen die Schwierigkeiten auf, eine kapitalistische Partei von innen zu verändern.
Die Grenzen der Kreativklasse
Die politische Botschaft der TV-Serie ist nicht immer ganz klar, sie zögert zum Beispiel, die menschlichen Kosten des Hacks zu zeigen. Wir hören News darüber, wie die Attacke die Wirtschaft verwüstet hat, aber die ZuschauerInnen bekommen nicht viel mehr zu sehen. Elliot zweifelt daran, ob die Revolution positive Effekte hatte, und wir sehen lange Schlangen vor den Bankautomaten und die Entstehung einer Schattenwirtschaft. Aber nichts davon scheint die Hauptpersonen zu betreffen – sie alle sind im oberen Dienstleistungs- und Kreativsektor beschäftigt. Im schlimmsten Fall müssen sie sich den Weg durch eine protestierende Menge bahnen, um zu ihrem teuren Dinner zu gelangen. Ihre ökonomische Position gibt den ProtagonistInnen allerdings auch Zugang zu den wichtigen Knotenpunkten des gegenwärtigen Kapitalismus: Elliot kann direkt Viren in die Firmenserver einschleusen; Angela kann auf belastende Dokumente von E Corp zugreifen. Aber ihr Versagen, positive Veränderungen zu bewirken, wirft die Frage über die Grenzen der politischen und ökonomischen Wirkung der Kreativklasse auf.
Bisher hat sich «Mr. Robot» nicht entschieden, ob die Revolution von «fsociety» gut oder schlecht ist. Die Show gibt keine Antworten. Sie zwingt uns aber, darüber nachzudenken, welche Formen ein radikaler Widerstand zum Kapitalismus annehmen könnte.