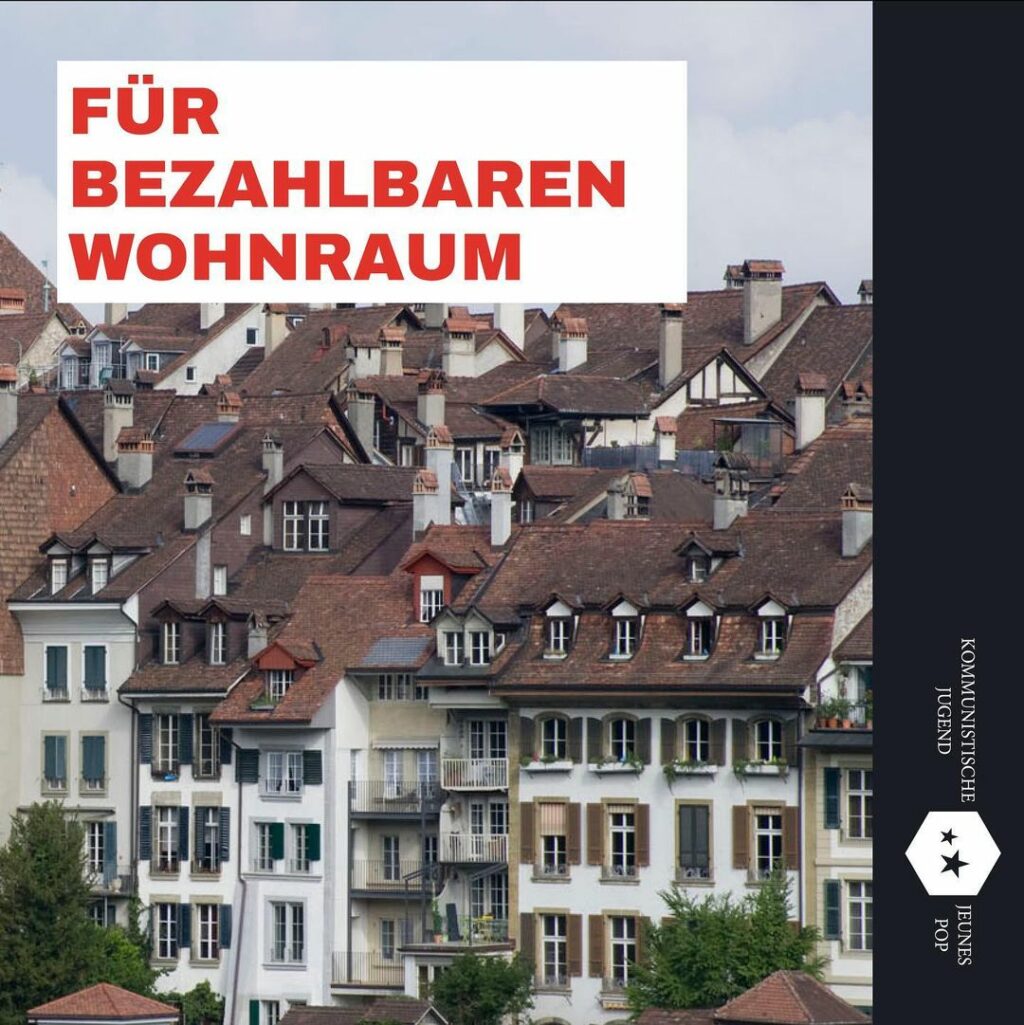Das Sommerloch nutzend hat der französische Präsident François Hollande im Juli die Operation «Barkhane» verkündet und ab dem 1. August 3’000 Soldat*innen in fünf Sahelstaaten stationiert. Aus der Intervention in Mali ist nun eine ständige Militärpräsenz Frankreichs in Afrika geworden. Die Medien wischten die Sache unter den Teppich, die Öffentlichkeit war in den Ferien.
Die Operation «Barkhane» kam nicht aus dem Nichts. Bereits Anfang 2014 hatte Verteidigungsminister Le Drian angekündigt, den Kontinent mit einem breiten Band aus Militärbasen zu überziehen. Das Ganze soll verstärkt werden durch ein mobiles Kontingent, das in der Lage sein soll, «diskreter von einem Punkt zum anderen zu springen». Wird es dann in Zukunft zu militärischen Einsätzen kommen, sollen die Behörden der betroffenen Länder nur noch informiert werden.
Das Vorhaben wurde wahr gemacht. Konkret sieht die Operation jetzt folgendermassen aus: Neben dem Hauptquartier in der tschadischen Hauptstadt N’Djamena werden sechs weitere Militärbasen eingerichtet in Burkina Faso, Mali, Mauretanien und Niger. Die Operation ist mit zwanzig Helikoptern, sechs Kampfjets, zehn Transportflugzeugen und mehreren Drohnen ausgerüstet. Die Verantwortung für «Barkhane» trägt General Palasset, der bereits ausgiebig Kriegserfahrung mit der Intervention in der Elfenbeinküste von 2010 und in Afghanistan sammeln konnte.
Krankes Frankreich
Über die Kosten der militärischen Einrichtungen wird nicht viel gesagt. Die Frage stellt sich: Kann sich Frankreich ein solches Unterfangen überhaupt leisten? Die ökonomische Situation Frankreichs sieht nicht gerade glänzend aus und schon länger wird es als der neue «kranke Mann Europas» bezeichnet. Der Einsatz dürfte politisch äusserst riskant sein für Präsident Hollande, wenn man bedenkt, dass die Bevölkerung noch immer unter der Wirtschaftskrise und der Sparpolitik leidet. So gesehen war der Zeitpunkt der Bekanntgabe der Operation ziemlich geschickt gewählt: Die Berichterstattung in den Medien war kaum wahrnehmbar, das öffentliche Interesse gering. Ein weiterer Faktor besteht vermutlich darin, dass die nun abgeschlossene Operation «Serval» – die Militärintervention in Mali – von der französischen Regierung als Erfolg vermarktet wird. Laut dem Verteidigungsminister seien die Ziele jener Operation erfüllt worden. Die Terrorist*innen seien eliminiert und ihre Waffenlager aufgelöst worden. Jetzt soll bloss das Wiedererstarken der Dschihadist*innen verhindert werden. Ein Hohn, wenn man sich die gegenwärtige Lage in Mali ansieht. Weder Frieden noch Sicherheit sind in das Land eingekehrt. Die Tuareg-Separatist*innen sind stärker als vor der Intervention. Und die Dschihadist*innen sind bloss geschwächt, nicht besiegt. Nachdem die Al-Qaida-nahen Kämpfer*innen vorübergehend in den Niger und Libyen abgetaucht waren, sind sie in kleineren Einheiten im Norden Mali wieder aktiv geworden. Aus dem offenen Krieg wurde ein Schattenkrieg. Auch konnten bislang die staatlichen Strukturen Malis in der Region nicht wiederaufgebaut werden. Beispielsweise die Stadt Kidal ist fest in den Händen von Tuareg-Rebell*innen. Als malische Regierungstruppen im Mai 2014 die Stadt erobern wollten, erlitten sie ein blutige Niederlage. Nicht nur für die malische Regierung, auch für Europa wäre die Angelegenheit peinlich gewesen, hätte der Westen davon Notiz genommen: Die Truppen waren von den Europäer*innen ausgebildet worden, besonders Deutschland war stark in das Trainingsprogramm involviert.
Die Probleme Malis
Die Probleme der Region sind komplexer, als dass man deren Ursache dem «Islamismus» und «Terrorismus» zuschieben könnte. Hier vermischen sich organisierte Kriminalität mit Separatismus, mit religiöser Hetze und staatlicher Korruption, und dann gibt es natürlich noch die erdrückende Armut der Bevölkerung. Die französische Aggression hat keine dieser Elemente, die in die Krise geführt haben, beseitigt. Die malische Regierung hat ihrerseits auch kaum versucht, eine Lösung der Krise im Norden des Landes zu finden. Ibrahim Boubacar Keïta, der 2013 im Eiltempo gewählte Präsident von Mali, hat sich ein kostspieliges Privatflugzeug genehmigt, hat Ämter und Posten auf Familienmitglieder verteilt, anstatt dass er auf die sozialen und politischen Forderungen des Nordens eingegangen wäre.
Zu Beginn begrüsste ein nicht unbedeutender Teil der malischen Bevölkerung den Eingriff der Französ*innen. Neueren Umfragen zufolge hat sich aber bei der grossen Mehrheit die Dankbarkeit durch Misstrauen ersetzt. Das Schwenken von Trikolorfähnchen beim Einmarsch der ehemaligen Kolonialmacht war wohl bloss ein Zeichen für fehlendes politisches Bewusstsein der Menschen. Das hat sich geändert. Heute warnen malische Oppositionelle wie die Globalisierungskritikerin Aminata Traoré vor dem französischen Eingreifen, vor Operationen wie «Serval» und ihrer Fortsetzung «Barkhane». Man dürfe Ursache und Folge von Dschihadismus nicht verwechseln. Sie wies darauf hin, dass es die Militarisierung der Sahelregion auch im Namen des von den USA geführten «Globalen Antiterrorkriegs» war und insbesondere die vor allem von Frankreich betriebene Zerschlagung Libyens 2011, welche die Bedrohung des Dschihadismus erst geschaffen haben. Die wahren Probleme des Sahel seien sozialer Natur und militärisch nicht zu lösen.
Uran aus dem Niger
Präsident Hollande hat den Beginn der Operation «Barkhane» während seiner dreitägigen Afrikareise angekündigt. Begleitet wurde er von einer grossen Delegation französischer Unternehmen. Die Interventionen werden mit der bedrohten Sicherheit Frankreichs und Europas begründet. Es gibt allerdings zu denken, dass beispielsweise in der Elfenbeinküste 800 französische Konzerne, darunter auch multinationale wie Orange, Bouygues und Bolloré, tätig sind. Und besonders der Niger spielt für Frankreichs Wirtschaft eine zentrale Rolle: Der französische Atomkonzern Areva fördert im Niger 40 Prozent des Uranbedarfs von Frankreich. Mit einem Atomstromanteil von 70 Prozent würde dem Land ohne diese Rohstoffquelle bald das Licht ausgehen. Seit längerem haben die beiden Staaten über ein neues Bergbaugesetz verhandelt, wonach Areva statt wie bisher 5.5 Prozent Steuern neu 12 Prozent zahlen muss. Im Mai wurde bekannt gegeben, dass sich die nigrische Seite durchsetzen konnte. Aber zu welchem Preis? Könnte das Einlenken Frankreichs etwas mit «Barkhane» zu tun haben, schliesslich hat der Areva-Konzern noch Anfang Jahr zwei Minen stillgelegt, um Druck auszuüben? Der Niger ist nun wieder ein Protektorat Frankreichs, Zufall?