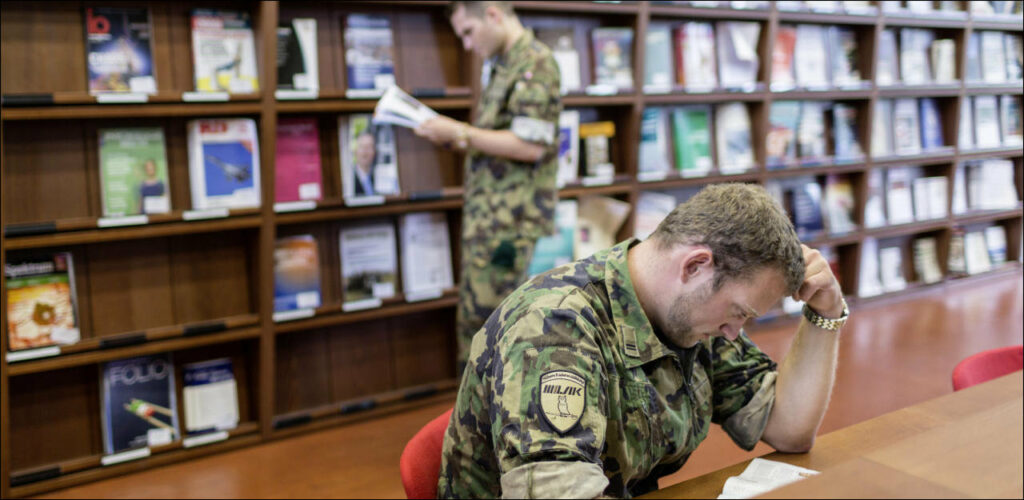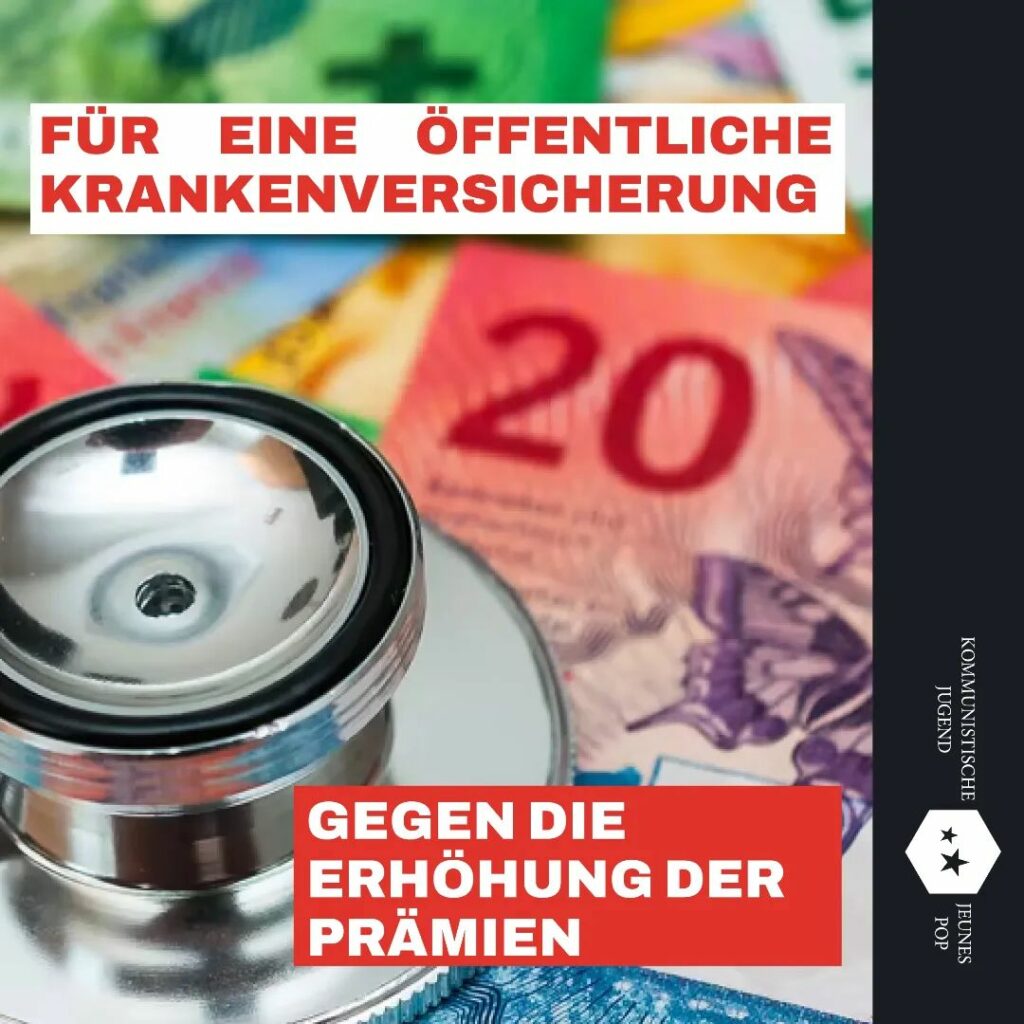Maria Galvão und António Veiga. In Brasilien wurde die Präsidentin Dilma Rousseff entmachtet. Die Linke im Land verurteilt den Putsch, kritisiert aber zum Teil auch die Politik der zuvor regierenden Partei.
Am 11. Mai 2016 hat der brasilianische Senat beschlossen, Präsidentin Dilma Rousseff vom Partido dos Trabalhadores (PT) für 180 Tage des Amtes zu entheben. Bis heute gibt es keinen Beweis für Rousseffs angebliche Verbrechen, der die Amtsenthebung juristisch begründen könnte. Die bisherige Opposition wirft Rousseff vor allem vor, Kredite aufgenommen zu haben, ohne das Parlament zu fragen, und die Bilanz der Staatsschulden gefälscht zu haben. Anscheinend sind diese Vorwürfe richtig. Nur: Die Praktiken, die Rousseff vorgeworfen werden, sind üblich. Die Parteien, die für Rousseffs Absetzung verantwortlich sind, haben in früheren Nationalregierungen und in den von ihnen kontrollierten Regionalregierungen nichts anderes getan.
Zerstörung der Demokratie
Mit dem Votum im Senat endet eine wichtige Etappe in der Offensive der reaktionären Kräfte des Landes: Als Übergangspräsident an die Stelle von Rousseff getreten ist Michel Temer von der Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Sein Kabinett besteht aus dreiundzwanzig Ministern – alles weisse Männer, die vor allem aus freikirchlichen Kreisen und dem Agrobusiness stammen. Temer kündigte bereits seine ersten Schritte an, dazu gehören unter anderem die Schliessung des Ministeriums für Kultur und des Ministeriums für ländliche Entwicklung. Eine massive Kürzung der Sozialprogramme und die Privatisierung wichtiger öffentlicher Sektoren werden voraussichtlich folgen, da diese bereits in dem Regierungsprogramm der PMDB zur letzten Präsidentschaftswahl klar benannt worden sind. Zu erwarten ist, dass die Austeritätspolitik ausgeweitet wird, die bereits die Regierung Rousseff stellenweise begonnen hat.
Der Partido Comunista do Brasil (PCdoB) beschreibt das Amtsenthebungsverfahren als einen Putsch, orchestriert von konservativen Kräften der Gesellschaft und damit Teilen der Justiz, den rechten Oppositionsparteien und den grössten Medienkonzernen Brasiliens.
Der PCdoB hebt hervor, dass das Amtsenthebungsverfahren illegal gewesen sei: «Eine Amtsenthebungsklage ohne Nachweis des Verbrechens schadet der Bundesverfassung, schafft einen Präzedenzfall für die Rücknahme der bereits eroberten Rechte und zerstört vor allem die Demokratie.»
Der PCdoB selbst ist seit 2003 Mitglied in der Regierungskoalition um Rousseffs PT und beschreibt den aktuellen Kampf für eine sozialistische Gesellschaft in Brasilien als einen Kampf um den Erfolg der PT-Regierung, die als die am weitesten fortgeschrittene und gangbarste Alternative verstanden wird, um die Ziele der eigenen Partei zu erreichen. Für den PCdoB ist das «Impeachment» daher nicht nur ein Putsch gegen die Verfassung, es sei auch ein Putsch gegen eine «populäre, demokratische und souveräne Bewegung».
Bruch oder Kontinuität?
Nach Ansicht dem Partido Comunista Brasileiro (PCB), dessen Orientierung sich von der des PCdoB deutlich unterscheidet, handelt es sich bei dem «Impeachment» gegen die Präsidentin nicht um einen Putsch, an dessen Ende eine wesentliche Veränderung der brasilianischen Politik steht. Denn der PT habe besonders seit den Präsidentschaftswahlen 2014 massive antisoziale Massnahmen durchgesetzt: Austeritätspolitik, Steuererhöhungen, Rentenreform. Der PT habe damit gezeigt, dass er gänzlich zu einer Partei des Kapitals geworden sei. Damit habe er sowohl einen Teil seiner Verankerung in der ArbeiterInnenklasse und den unterdrückten Volksschichten verloren, als auch seine Funktion als «Dämpfer» des Klassenkampfs zumindest teilweise eingebüsst. Die aktuelle politische Entwicklung basiere daher im Wesentlichen darauf, die Austeritätspolitik im Interesse des Kapitals angesichts der Krise in einer schnelleren und kompromissloseren Art und Weise umzusetzen. Im Bezug auf die Frage der Legitimität des «Impeachment» analysiert der PCB: «Dieser Prozess zeigt, dass die formalen Regeln der bürgerlichen Demokratie nur dann von der herrschenden Klasse respektiert werden, solange sie ihren Interessen dienen.»