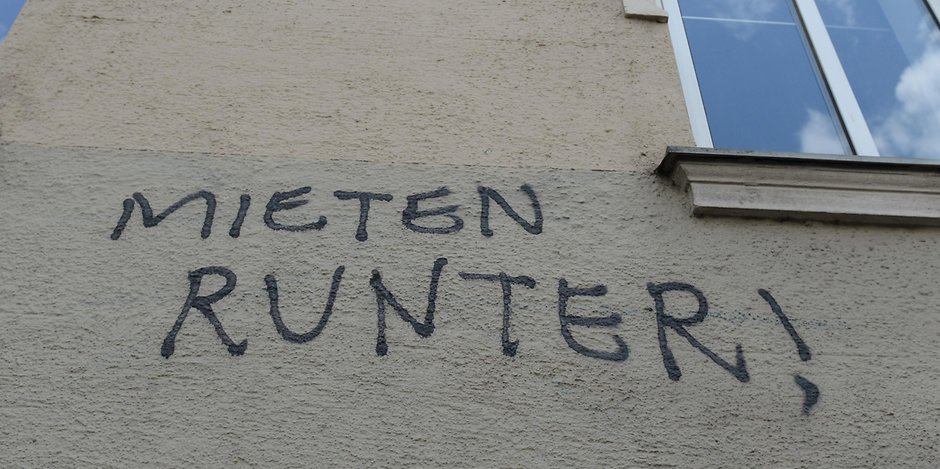In Hamburg läuft hinter verschlossenen Türen der erste Prozess gegen angebliche Teilnehmer der autofeindlichen Demonstration auf der Elbchaussee zum G20-Gipfel am 7. Juli 2017.
Die Anklage richtet sich gegen fünf angebliche Teilnehmer einer Demonstration am Tag der Gipfelblockaden, dem 7. Juli 2017 auf der Hamburger Elbchaussee. Am Rande der Versammlung wurden 19 geparkte Autos angezündet und Schaufensterscheiben eingeworfen. Gegen vier Hessen und einen Franzosen läuft seit dem 18. Dezember vor dem Landgericht Hamburg ein Prozess. Identifiziert worden seien sie anhand von Videobildern, heisst es bei der Staatsanwaltschaft. Zwei der Angeklagten waren 2017 erst 16, minderjährig. Deshalb findet der Prozess vor einer Jugendkammer statt. Die beiden mittlerweile 18-jährigen wurden bereits kurz nach ihrer Verhaftung Ende Juni 2018 wieder freigelassen. Die beiden anderen aus Hessen sitzen seit Ende Juni in Untersuchungshaft. Der 23-jährige aus Ostfrankreich wurde dort im August verhaftet am 5. Oktober 2018 überstellt und sitzt ebenfalls in U-Haft.
Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Landfriedensbruch in einem besonders schweren Fall vor, Mittäterschaft bei Brandstiftung, gefährliche Körperverletzung sowie einen Verstoss gegen das Waffengesetz – ohne dass ihnen eine konkrete Tatbeteiligung nachgewiesen worden ist.
«Psychische Beihilfe»
Als am ersten Prozesstag die Angeklagten den Gerichtssaal betraten, brandete Applaus aus dem durch eine Glasscheibe abgetrennten, gut gefüllten Zuschauer*innenraum auf. Am Vorabend gab es eine Solidaritätsdemonstration von der Roten Flora zur Untersuchungshaftanstalt. Am 10. Januar wurde die Öffentlichkeit auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das Gericht vom Prozess ausgeschlossen – angeblich zum Schutz der Angeklagten. Nur einem der fünf Angeklagten wird überhaupt eine angebliche direkte Beteiligung an Sachbeschädigungen vorgeworfen, den anderen vier bloss die angebliche Teilnahme an der Versammlung. Staatsanwalt Tim Paschkowski wirft den Angeklagten vor, am 7. Juli 2017 an einem Marsch von 220 grösstenteils vermummten und dunkel gekleideten Personen teilgenommen zu haben, aus dem heraus zahlreiche Straftaten begangen worden seien. Es gehe um einen Sachschaden von einer Million Euro. Aber keine der zahlreichen Videoaufnahmen, die als Beweismittel präsentiert wurden, lieferte einen Hinweis darauf, dass einer der Angeklagten eigenhändig Schaufensterscheiben eingeworfen, Autos in Brand gesetzt oder Steine geschleudert habe. Allein durch ihre Teilnahme hätten sie den Gewalttäter*innen aber «psychische Beihilfe» geleistet. Somit sei ihnen jede einzelne aus der Menge begangene Straftat rechtlich zuzuordnen.
Gewagte Rechtsauslegung
Es sei eindeutig keine Demonstration gewesen, deren Teilnehmer*innen unter dem Schutz des Versammlungsrechts stehen. Vielmehr habe es «einen gemeinsamen Tatentschluss» gegeben, eine Verabredung zu Straftaten, die durch «gewollt arbeitsteiliges Zusammenwirken» verübt worden seien. Eine gewagte Rechtsauslegung. Die Verteidigerin Gabriele Heinecke nahm die Anklageschrift bereits zu Prozessbeginn auseinander: Die Rede sei von «mehreren gewaltbereiten Beteiligten», also nicht davon, dass alle Marschierer militant waren. Den Angeklagten werde gar nicht «vorgeworfen, eigenhändig Straftaten begangen zu haben», vorliegende Videosequenzen gäben keinen Hinweis darauf, dass sie die «Straftaten auch nur gebilligt» hätten. Ausserdem habe die Versammlung vom Transparent bis hin zur Formation «alle Attribute einer Demonstration» aufgewiesen: Folglich gelte der Schutz des Versammlungsrechts, dass friedliche und unfriedliche Teilnehmer*innen genau voneinander unterscheidet.
Aber die Hamburger Staatsanwaltschaft versucht, im Falle des Elbchaussee-Prozesses wie beim Rondenberg-Prozess, die Teilnahme an einer Demonstration mit einer verabredeten Schlägerei zwischen Hooligans gleichzusetzen. Die angeklagten Demonstranten seien genauso wie Hooligans einzustufen und sollten deshalb für alle Taten mit haften, die aus der gewalttätigen Gruppe heraus begangen worden seien. Was das nach ihrer Rechtsauslegung bedeutet, hat die Staatsanwaltschaft bereits im Vorfeld deutlich gemacht: Als im Rahmen einer Entscheidung über die Haftverschonung für die zwei älteren Beschuldigten die Jugendkammer unter der Richterin Anne Meier-Göring im November die vorläufige Rechtseinschätzung äusserte, die Angeklagten hätten vermutlich mit Haftstrafen von höchstens drei Jahren zu rechnen, reichte das den Anklägern; sie beantragten, Meier-Göring das Verfahren wegen Befangenheit zu entziehen. Richterin Anne Meier-Göring habe, so die Ankläger, «die Dimension der Taten» nicht berücksichtigt. Zu erwarten sei vielmehr eine Strafe von sechs bis zehn Jahren Haft.
«Arbeitshypothesen»
Mit dieser Vorwärtsstrategie versuchte die Staatsanwaltschaft, Meier-Göring keine Gelegenheit zu geben, die Ermittlungsarbeit der Polizei zu kritisieren. Doch obwohl die Öffentlichkeit aus dem Elbchaussee-Prozess ausgeschlossen ist, bekam der NDR interessante Informationen darüber: Die angeblich beweiskräftigen Akten der Anklage, zusammengestellt von der Ermittlungsgruppe «Schwarzer Block», hält die Jugendkammer «nicht für gerichtsfest». Auf das «geschriebene Wort» sei «wenig Verlass», soll es in einem Beschluss der zuständigen Kammer des Landgerichts Hamburg vom 1. März heissen.
Zeugen sollen bei ihrer Vernehmung während der Hauptverhandlung Aussagen entschieden bestritten haben, die die Polizei in deren Namen in der Ermittlungsakte vermerkt hatte, so Stella Peters vom NDR. Zeugen sollen Polizeivermerke gar als Quatsch bezeichnet haben – solche Aussagen hätten sie nie gemacht. Den Recherchen zufolge wollen sich die Richter*innen darum nicht mehr auf «weitere Polizeivermerke» verlassen und laden stattdessen deutlich mehr Zeugen vor als ursprünglich geplant. So wird der Prozess mindestens bis im September dauern. Auch die Vernehmung des Ermittlungsleiters der Polizei von der Ermittlungsgruppe «Schwarzer Block» habe zu Zweifeln an dessen Abschlussbericht geführt, da er selbst angebliche Ermittlungsergebnisse vor Gericht als «Arbeitshypothesen» bezeichnet hatte. Auch aus Sicht der Polizei sei «keineswegs alles so klar, wie der Abschlussbericht vermuten lasse» schrieb die Kammer der Richterin Anne Meier-Göring in ihrem Beschluss vom 1. März. Selbst die Videos vom Aufmarsch auf der Elbchaussee seien ohne die aus Sicht der Richter*innen «suggestiven Bearbeitungen» der Polizei nicht so beweiskräftig wie es zunächst scheine. Im Polizeipräsidium in Hamburg-Alsterdorf sorgt diese offene Kritik für Unmut – ebenso wie in den Bürocontainern der Ermittlungsgruppe «Schwarzer Block», wo nach wie vor 45 Beamte gegen den G20-Protest ermitteln.
Vorwärts Link
https://www.vorwaerts.ch/international/unter-ausschluss-der-oeffentlichkeit/